 Inklusion lebt auch von guten Ideen: So sieht sie aus, die wunderbare Rollstuhl-Rikscha, die das Frida Kahlo Haus anschaffen möchte und auf dem Sommerfest probefahren durfte! Die TestpilotInnen – Bewohnerin und Einrichtungsleiter – waren begeistert.
Inklusion lebt auch von guten Ideen: So sieht sie aus, die wunderbare Rollstuhl-Rikscha, die das Frida Kahlo Haus anschaffen möchte und auf dem Sommerfest probefahren durfte! Die TestpilotInnen – Bewohnerin und Einrichtungsleiter – waren begeistert.  Das große Sommerrätsel ist gelüftet: Die Dachterrasse im Paul Schneider Haus ist eröffnet!
Das große Sommerrätsel ist gelüftet: Die Dachterrasse im Paul Schneider Haus ist eröffnet!
Der „Dschungel“ – Oleander und Palmen, Bambus und weitere Pflanzen, die vom Süden träumen lassen – wurden auf Anhängern herbeitransportiert, im Aufzug in den 3. Stock gefahren und von fleißigen Mitarbeitenden wunderschön arrangiert.
Kleine Lampions, eine Hollywoodschaukel, eine helle Markise als Sonnenschutz und viele Tische und Stühle laden nun zum Verweilen unter freiem Himmel ein und verbreiten Urlaubsflair.
Die Dachterrasse ist vom Speisesaal aus zugänglich und steht Bewohnerinnen und Bewohnern, Mitarbeitenden und Gästen zur Verfügung.
Kita-Platz frei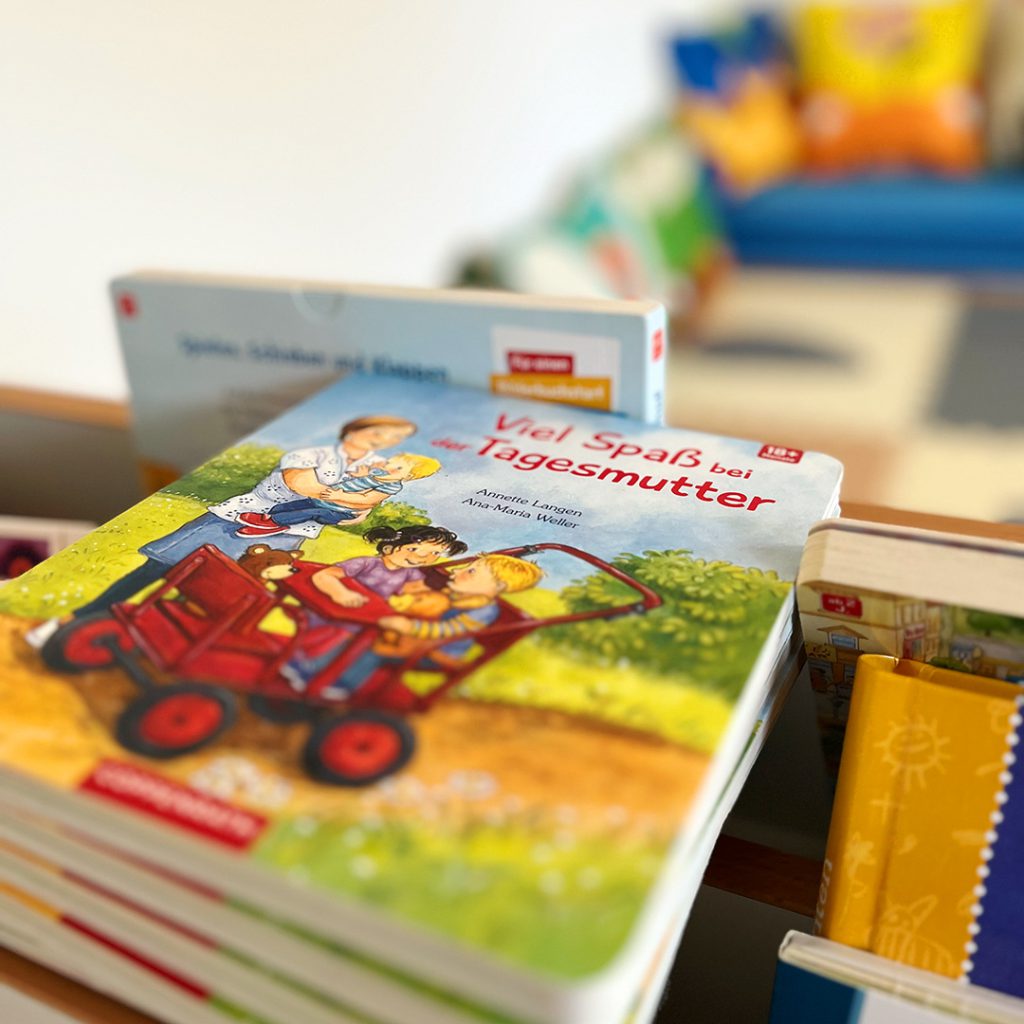 Ein Platz ist kurzfristig frei geworden bei unseren Tagesmüttern auf dem Clarenbachwerk-Gelände in Müngersdorf: Zum 1. September 2025 bietet Frau Razmjo Kinder-Tagesbetreuung mit 45 Wochenstunden für 0–3-Jährige an, jeweils zwischen 6 und 15 Uhr.
Ein Platz ist kurzfristig frei geworden bei unseren Tagesmüttern auf dem Clarenbachwerk-Gelände in Müngersdorf: Zum 1. September 2025 bietet Frau Razmjo Kinder-Tagesbetreuung mit 45 Wochenstunden für 0–3-Jährige an, jeweils zwischen 6 und 15 Uhr.Die Kinder von Mitarbeitenden des Clarenbachwerks werden bei der Platzvergabe bevorzugt.
Namibia ist nicht einfach nur ein Reiseziel. Zwischen Atlantik, Sandmeer und Savanne bietet es eine Vielfalt, die so kontrastreich ist wie kaum anderswo. Hier trifft staubige Trockenheit auf tropisches Grün, Stille auf tosende Wasserfälle – und nirgends scheint das Licht intensiver, ist der Himmel weiter, sind die Farben klarer.
Wer hier unterwegs ist, braucht nicht viel: einen Landy (ein geländegängiges Fahrzeug), ein offenes Herz und Zeit. Denn dieses Land verlangt Langsamkeit. Nicht nur wegen der holprigen Pisten, sondern weil man es erleben sollte, nicht nur durchqueren.
Das Licht in Namibia ist ein Ereignis für sich. Morgens liegt es warm- golden über den Dünen, mittags gleißend über der Steppe und abends taucht es das Land in Rot, Violett und tiefstes Blau. Und dann ist da dieser Himmel: so hoch, so klar, so unglaublich blau, dass er fast surreal wirkt. Wer je in Namibia war, weiß – so blau wie in Namibia ist der Himmel nirgends.
Namib Wüste
Die Namib gilt als eine der ältesten Wüsten auf diesem Planeten und wir sind uns sicher: es ist die schönste! Zwischen roten Dünen, dem Dead Vlei und Soussusvlei fühlt man sich wie auf einem anderen Planeten. Absolute Stil- le – nur die schwarzen Skelette abgestorbener Kameldornbäume auf weißem Lehmboden. Auch wenn der Namib Naukluft Nationalpark in den letzten Jahren immer mehr Besucher verzeichnet, ist das Gebiet rund ums Sossusvlei landschaftlich nach wie vor ein echter Kracher. Nirgends ist der Himmel blauer, und wenn die riesigen Sanddünen morgens und abends tiefrot leuchten und Schatten werfen, kriegt man den Mund nicht mehr zu.
Wer es wagt, sie zu erklimmen, wird mit Ausblicken belohnt, die einem im- mer wieder sprachlos machen … Und jedes Mal sehen diese Wanderdünen anders aus und jedes Mal beeindrucken sie uns erneut.
Sandwich Harbour
Im Westen drängt sich die Namib bis ans Meer. Bei Sandwich Harbour stoßen Dünen direkt auf den Atlantik. Hier am Meer fristen mit Swakopmund und Walvis Bay zwei Örtchen ihr Dasein, die uns nicht wirklich vom Hocker reißen. Lohnenswert ist allerdings ein Ausflug nach Sand- wich Harbour. Die Landschaft ist spektakulär! Hier trifft der raue At- lantik direkt auf die Sanddünen der Namib (rechts Dünen, links Meer), was eine richtig imposante Kulisse abgibt. Tatsächlich ist der Sand hier jedoch viel „weicher“ als in Sossusvlei. Dass auch wir uns festfahren, ist Ehrensache :-)!
Purros & Marienfluss
Wir fahren weiter in Namibias trockenen Nordwesten und sind damit im Gebiet der Trockenflüsse angekommen. Eines der spektakulärsten Trockenriviere ist der Hoanib, der sich hier über die Jahrhunderte ins Gestein gegraben und dabei einen Canyon geformt hat – Heimat der Wüstenelefanten, kleiner Giraffenpopulationen und einer Handvoll Oryxe und Zebras. Sie sind auf der Suche nach Untergrund- wasser und etwas Fressbarem in diesem extrem trockenen Gebiet. Die Elefanten sind dabei fast süchtig nach den alten Winterthorn trees und vor allem die Bullen strecken sich in Zirkusmanier, um an deren Früchte zu kommen.
Kaokeland
Noch weiter nördlich sind wir im Kaokoland angekommen – Heimat der Himba. Dadurch, dass bis in die 90er Jahre keine Straße in diese Region führte, haben sich die Himba ihre traditionelle Lebensweise bewahrt. Sie sind Viehnomaden, bei denen sich Wohlstand und Prestige an der Anzahl der Rinder ablesen lässt. Die Frauen reiben Haut und Haare mit einem Ge- misch aus zerstoßenen Ockersteinen und Fett ein, um sich vor Insekten und der starken Sonneneinstrahlung zu schützen. Hier gibt es totale Einsamkeit, eine unglaubliche Weite und vor allem Sand, Sand und Sand. Ab und zu kreuzen ein paar Strauße oder ein Oryx die Piste und bis man sich dem Rauschen des Kunene nähert, der das Valley im Norden begrenzt, ist es ohrenbetäubend still.
Epupa Falls
Und dann, nach Stunden durch Staub und Dürre fährt man in Epupa über einen Hügel und der Blick öffnet sich auf den Kunene, der die völlig karge Landschaft hier plötzlich in üppiges Grün verwandelt: die Epupa Falls. Der Kunene-Fluss rauscht über Felsen, umrahmt von Makalanipalmen und sattem Grün. Ein kleines Paradies – überraschend, wild und wunderschön. Hier zu campen, mit Blick auf die Fälle, bei einem Sundowner unter dem afrikanischen Sternenhimmel, ist nicht das Allerschlechteste …
Etosha
Der Etosha Nationalpark im Norden – ein weiteres Highlight in Namibia – schützt eine riesige Salzpfanne und einen großen Wildtierbestand. Je nach Regenzeit ist es hier entweder staubtrocken oder erstaunlich grün. Etosha bedeutete in der Ovambo Sprache „großer weißer Platz“ – end- loser Horizont und spektakuläre Tierbegegnungen. Während der Trockenzeit fährt man hier einfach eines der vielen Wasserlöcher an, um die Tiere zu sehen. Da die Regenzeit dieses Jahr aber offensichtlich sehr gut ausfällt, präsentiert sich Etosha erstaunlich grün, was das Aufspüren der Tiere deutlich schwieriger macht.
Momentan sind Etoshas Vierbeiner jedoch nicht auf die Wasserquellen angewiesen, da durch den Regen überall riesige Pfützen stehen. Besonders im Gebiet um Okaukuejo (westliches Etosha) gestalten sich unsere Pirschfahrten ziemlich schwierig. Das einzige Tier, was wir hier regelmäßig zu Gesicht bekommen, ist ein von der Salzpfanne fast weißes Nashorn. Im Gebiet um Namutoni (östliches Etosha) werden wir hingegen mit verschiedenen Katzenarten belohnt, darunter auch einem Löwenrudel mit vielen Jungtieren, was eine gute Stunde um unseren Landy herumschwänzelt – besser als jeder Tatort 🙂 !
Caprivi – Der grüne Osten
Fährt man von dem staubigen Wes- ten immer weiter in den Osten, landet man irgendwann im Caprivizipfel. Hier wird alles anders. Tropische Landschaft, große Flüsse und Wälder durchziehen die heutige Zambezi Region, die viele Naturschutzgebiete und kleinere Dörfer beherbergt, es riecht nach Feuerholz und das Leben pulsiert. Auf der Fahrt über Land sieht man die ersten Rundhütten und kleinere Marktstände. Man begegnet den ersten Fahrradfahrern oder Frauen, die Wasser auf dem Kopf tragen und ständig kreuzen Ziegen, Kühe oder Hühner die Straße. Die Namibier sagen: „Hier beginnt Afrika!“ – was wir absolut bestätigen können.
Erongo
Ein weiteres landschaftliches Highlight ist das Erongo-Gebirge. Hier sind durch Erosion bizarre Felsformationen entstanden und es gibt riesige Kugeln, Säulen oder überdimensionale Buchstaben. Mitten in diesem Gebiet liegt die Ameib Ranch, die sich auch heute noch in Privatbesitz befindet. Hier kann man Stunden verbringen und der Fotoapparat steht nicht mehr still. Besonders beliebt ist das Gebiet um die „Bull’s Party“, was an ein riesiges, natürliches Amphitheater erinnert, dicht gefolgt vom „Elephants Head“ (s. Foto links)
spitzkoppe
Einige Kilometer weiter westlich liegt die Spitzkoppe, mit 1.728 Metern der höchste Gipfel im Erongo-Gebirge. Sie wird aufgrund ihrer markanten Form auch als „Matterhorn Namibias“ bezeichnet – ein weiteres Wahrzeichen vom Erongo-Gebirge. Auch hier gibt es sehr skurrile Felsformationen, darunter natürliche Bögen und überdimensionale Felsen.
Fazit
Namibia ist kein Land, das man mal eben „bereist“. Es ist ein Land, mit einer unglaublichen Vielfalt: Hier trifft man auf rote Sanddünen, die aussehen wie von einem anderen Planeten, auf Elefanten in Flussbetten, in denen seit Monaten kein Tropfen Wasser floss, auf Wasserfälle mitten im Nirgendwo und auf Stille – man hört nur den eigenen Tinnitus.
Namibia ist das Land der großen Kontraste: morgens Wüste, mittags Savanne, abends Palmen am Fluss und das mit einem extrem blauen Himmel. Denn ganz gleich, ob man in der Namib Dünen besteigt, sich in Sandwich Harbour im Sand fest- fährt, bei den Epupa-Fällen den Fluss rauschen hört oder in Etosha den Tieren beim Trinken zuschaut – Namibia bleibt im Kopf, geht unter die Haut und lässt einen nicht mehr los – so blau wie in Namibia ist der Himmel nirgends. Lena Klemm
Weiterlesen auf dem Reiseblog www.colognetocapetown.com
Musizierende des Gürzenich-Orchesters besuchten das Heinrich Püschel Haus und begeisterten die Bewohnerinnen und Bewohner mit einem tollen Konzert!
Weiterbildung Pflegedienstleitung 2Herzlichen Glückwunsch! Ihre Weiterbildung zur Pflegedienstleitung haben Frau Wedell und Frau Vural (Häuser Paulus/Stephanus) sowie Frau Özkurt (Anne Frank/Paul Schneider Haus) bestanden und wurden von ihren Einrichtungsleitungen zum Zertifikat beglückwünscht – auch wir gratulieren zu der tollen Leistung!
Integrationsbeauftragte hilft MitarbeitendenEdita Zickert ist seit einiger Zeit die Integrationsbeauftragte des Clarenbachwerks. Was genau das ist und warum es eine gleichermaßen wichtige wie schöne Tätigkeit ist, erläutert sie im Interview.
Georg Salzberger: Ich freue mich, dass es mit unserem Gespräch so schnell geklappt hat und ich etwas über die Integrationsbeauftragte des Clarenbachwerks erfahren kann. Ausgangspunkt für mich waren Fotos von einer Stadtführung mit Ihnen und neuen Mitarbeitenden des Clarenbachwerks. Die Fotos drücken meines Erachtens bildhaft aus, worum es bei Integration geht. Stimmt das? Und was ist das eigentlich, eine Integrationsbeauftragte, was macht die genau und wie sind Sie zur Integrationsbeauftragten geworden?
Edita Zickert: Frau Richter hat mich angesprochen, auf Empfehlung von Herrn Schröder. Das Clarenbachwerk hat genauso wie viele andere Träger mit dem Notstand zu tun, zu wenig Pflegekräfte anstellen zu können, vor allem zu wenig examinierte. Eine Maßnahme, das zu ändern, besteht darin, Pflegekräfte aus dem Ausland zu rekrutieren. Das hat Frau Rönneper initiiert. Das ist übrigens nichts ganz Neues, das läuft schon seit einigen Jahren. Es gibt verschiedene Firmen, die das machen und das Clarenbachwerk arbeitet mit drei Firmen zusammen: Triple Win, diese Firma arbeitet mit der Bundesagentur für Arbeit zusammen, die rekrutieren hauptsächlich Pflegekräfte aus Indien, aus Kerala. Dann ist da die Firma Iuvare, über die haben wir drei tunesische Pflegekräfte vermittelt bekommen. Die sind schon gut hier angekommen, sie warten auf die letzten unerledigten Papiere, zum Bespiel den Stempel des Ausländeramtes. Und schließlich arbeiten wir noch mit der Firma Dekra zusammen, diese Firma hat uns Pflegekräfte aus Albanien vermittelt. Jede Firma handhabt das anders, der Prozess ist jeweils anders. Und da braucht man jemanden, der das alles im Blick behält. Deshalb ist es wichtig, eine Integrationsbeauftragte zu haben.
gS: Warum sind die Verantwortlichen des Clarenbachwerks auf Sie gekommen?
eZ: Vielleicht bin ich ein gutes Beispiel für gelungene Integration. Ich komme ja aus Litauen und habe fast das Gleiche durchmachen müssen. Ich weiß, wie schwer das ist, was für Probleme man hat. Ja, es gibt eine Reihe von Sachen, an die man selbst gar nicht denkt, bzw. denkt man nicht daran, dass es ein Problem sein könnte. Zum Beispiel hat mir eine Inderin erzählt, wir unterhielten uns über allerhand und ich fragte: „Was war für dich komisch, interessant oder ungewöhnlich, als du nach Deutschland gekommen bist, was war quasi ein Kulturschock?“ Daraufhin meinte sie, ja besonders die Ampel. „Wieso die Ampel?“, erwiderte ich, die gibt es doch auch in Indien. „Na klar gibt es in Indien auch Ampeln, aber kein Mensch bleibt bei Rot stehen.“
gS: Da ist sie doch in Köln genau am richtigen Ort, die Kölner sind auch nicht besonders ehrfürchtig bei roten Ampeln …
eZ: Trotzdem ist es natürlich wichtig, auf solche Eigenarten hinzuweisen. Das hat in diesem Fall auch Frau Janes gemacht, die hat eine Patenschaft übernommen, um eben das Ankommen und Hiersein zu erleichtern.
gS: Kann ich sagen, Sie hätten sich seinerzeit auch eine Integrationshilfe gewünscht, als sie neu in Köln waren?
eZ: Bei mir war das eine andere Situation, ich bin zunächst als Au Pair gekommen, das heißt ich war in einer Familie, die mich sehr nett an die neue Umgebung und Situation herangeführt hat, die sozusagen auch Integrationsbeauftragte für mich waren. Denn es geht natürlich nicht nur um Ampeln, das ist eher unwichtig. Herausfordernd sind die Behördengänge, wo bekomme ich eine Handy-Sim-Karte her, wie aktiviere ich die, Anmeldung bei der Stadt Köln, beim Ausländeramt, was muss ich tun, damit meine Abschlüsse hier anerkannt werden. Und natürlich arbeite ich eng mit den Häusern zusammen. Ganz wichtig aber ist, dass ich mich nach den Neuankömmlingen erkundige, frage, wie geht es, was fehlt, gefällt die Arbeit, wie ist das Verhältnis zu den Kollegen usw. Eine Inderin hat mich am besten beschrieben, als sie gefragt wurde, wer ich sei: „Das ist unsere Freundin, unser alles!“
gS: Sie sind, wenn man so will, für die Willkommenskultur zuständig. Wir können uns alle vorstellen, wie schwierig ein Anfang in einem neuen Land ist, mit fremder Sprache, anderer Kultur. Da ist es schon eine sehr große Hilfe, wenn man jemanden an der Seite hat, den man alles fragen kann und die einem alles zeigt und erklärt.
eZ: Ich helfe einfach bei den ersten Schritten. Jetzt fällt mir gerade ein, eine Pflegerin, die in Deckstein arbeitet, aber in Müngersdorf wohnt, ihr habe ich dann gezeigt, wie sie an ein Deutschland-Ticket kommt und ich bin mir ihr die Strecke nach Deckstein mit Bus und Bahn abgefahren. Letzthin habe ich auch eine Pflegerin ins Krankenhaus begleitet, als sie plötzlich krank wurde.
gS: Ihre Tätigkeit richtet sich nach dem Bedarf, den die Neuankömmlinge haben?
eZ: Genau, deshalb kann ich auch gar nicht genau sagen, was ich mache, gemacht habe, was alles dazu gehört. Das entscheiden die neuen Pflegekräfte. Es kommt immer drauf an, was sie brauchen, was sie wünschen.
gS: Wie viele Mitarbeitende haben Sie inzwischen begleitet?
eZ: Drei aus Tunesien, drei aus Albanien und drei aus Indien.
gS: Und alle haben Wohnungen im Clarenbachwerk?
eZ: Genau, entweder im Stephanus/Paulus oder im Haus Martin Luther King. Eine neue Kollegin wohnt in Düren, die hat da Familie und die haben ihr eine Wohnung organisiert, haben sich auch um die Anmeldung gekümmert, ich musste mich nur noch um die Krankenversicherung kümmern.
gS: Und Sie machen das gerne?
eZ: Ja, sehr gerne!
gS: Können Sie beschreiben, warum?
eZ: Weil das sehr abwechslungsreich ist, wie gesagt, man weiß nie was kommt. Und die Menschen sind alle nett, man hat einen schönen Austausch mit anderen Menschen aus anderen Kulturen. Sinnvoll ist die Arbeit und sie ist schön, unter anderem, weil man Ergebnisse sieht. Ich freue mich, wenn Prüfungen, zu denen ich begleite, bestanden werden. Bei allen Tätigkeiten gibt es Ergebnisse, an denen man den Erfolg der Bemühungen erkennen kann.
gS: Und es ist sicherlich ein Segen, wenn Sie das gerne machen, dann fühlt man sich als Neuankömmling direkt willkommen. Nochmal zurück zu den Fotos, die ich gesehen habe und die mich angesprochen haben.
eZ: Eine Stadtführung, das war die Idee von Frau Klemm. Die war schon früher involviert, hat die Begleitung zunächst gemacht und sich um drei Mitarbeitende aus Tunesien und zwei Kolleginnen aus Indien gekümmert und hatte dann auch die Idee mit einer Stadtführung, um allen Neuankömmlingen Köln zu zeigen. Als sie mir das erzählt hat, habe ich direkt an Uli (Kievernagel) gedacht, den Köln-Lotsen, einen besseren gibt es nicht. Ich habe ihn dann angerufen, er hat sich sehr gefreut und Uli hat uns auf seine lebendige Art und Weise Köln und seine Eigenheiten gezeigt.
gS: Und wie war das für die Neukölnerinnen und Neukölner, war Köln für sie sehr fremd?
eZ: Ich glaube, das war für die meisten nicht sehr fremd, die sind ja schon ein paar Monate hier, die kannten Köln schon ein bisschen. Aber die Führung fand sehr guten Anklang, war schön und interessant.
gS: Auch was den Karneval angeht?
eZ: Niketta aus Albanien musste einen Schwur auf die Roten Funken ablegen, wir standen dabei, alle mit roten Nasen.
gS: Und werden die Teilnehmenden alle aktiv sein am Elften im Elften?
eZ: Alle nicht, aber einige bestimmt. Die erwähnte Dame aus Albanien, Niketta, trug beim diesjährigen Betriebsfest die Anstecknadel der Roten Funken, die sie bekommen hatte.
gS: Haben Sie eigentlich das Gefühl, dass es Köln den Neuankömmlingen leicht macht, wie man das immer so sagt oder behauptet? Dass Köln eine Stadt ist, zu der „Immis“ schnell Zugang findet?
eZ: Auf jeden Fall, Köln ist zurecht dafür bekannt. Aber die Behörden … eher nicht!
gS: Gibt es Aspekte, nach denen ich noch nicht gefragt habe, die Ihnen aber noch wichtig sind?
eZ: Wichtig ist unbedingt noch, dass wir Paten suchen für unsere neuen Kolleginnen und Kollegen. Diese Paten sollten auch Spaß haben, die Neuankömmlinge miteinzubeziehen, sie mal abends mitnehmen, zum Beispiel zum Weihnachtsmarkt, sie einfach mit einbinden. Auch, um die Deutschkenntnisse noch zu verbessern, gibt es nichts Besseres als Kontakt zu deutschen Kolleginnen und Kollegen. Einige Neuankömmlinge kannten sich bereits, die anderen habe ich mit-
einander bekannt gemacht, aber um dauerhaft gut hier leben zu können, wäre es wichtig, dass sich ihr Kreis an Mitmenschen erweitert.
Und ich möchte noch erwähnen, dass ich nicht alles allein mache, sondern zusammen mit Chiara Rönneper und Lena Klemm, mit denen ich mich regelmäßig austausche, nicht nur, wenn ich mal nicht weiter weiß!
gS: Vielen Dank, Frau Zickert für diesen anschaulichen Einblick in ihre Tätigkeit als Integrationsbeauftragte!
Tipp: Radiobeitrag zum Thema
„Auslandsrecruiting“ in „Neugier genügt“/WDR 5, in dem auch vom Clarenbachwerk berichtet wird. Sendetermin voraussichtlich 25.3., anschl. in der Mediathek: https://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/neugier-genuegt/index.html
UNTERSTÜTZUNG GESUCHT!
Worüber würden wir uns freuen, wenn wir für einen neuen Job in ein anderes Land mit einer fremden Kultur kämen? Wohl vor allem über Interesse, Kontakte und hilfreiche Tipps.
Deshalb suchen wir offene Menschen, die unseren neuen Mitarbeitenden (alle haben Deutschkenntnisse auf B2-Niveau) ab und zu etwas von Köln und seinem Angebot zeigen. Zum Austausch oder für gemeinsame Aktivitäten, z. B. Einkaufen, Feste, Freizeit-, Kultur- oder Sportveranstaltungen.
Interessierte melden sich bitte bei Editha Zickert unter
Gerne auch weitergeben an Freunde und Bekannte – vielen Dank!
Schuldgefühle: die – etwas andere – Schuldenfalle
Wenn Schuldgefühle gar nichts mit realer Schuld zu tun haben, wie Georg Salzberger erläutert, was bedeuten Schuldgefühle dann?
Bei Schulden denken wir an Geld, an Schuldner und Gläubiger. Bei Schuld liegt es nahe, dass ihr eine Verfehlung, eine Verletzung zugrunde liegt. Schuldgefühle, um die es hier gehen soll, haben weder mit Geld noch mit realer Schuld zu tun. Dennoch sind Schuldgefühle sehr verbreitet. In sogenannt sorgenden Institutionen wie zum Beispiel im Gesundheitswesen findet man Schuldgefühle zuhauf: Menschen, deren Angehörige von unheilbarem Leid betroffen sind, machen sich fast immer Schuldvorwürfe. Quälender noch sind Schuldgefühle von Menschen, deren Ehepartner, deren Kind oder andere nahe Verwandte sich suizidiert haben. Sie fragen sich, was sie übersehen haben und ob sie den Suizid nicht hätten verhindern können, ja müssen. Fast noch dramatischer sind die Schuldgefühle von Menschen, die als Kind misshandelt oder missbraucht wurden – und dass, obwohl sie sich nichts zu Schulden haben kommen lassen, sondern Opfer sind. Ebenso dramatisch ist die „Überlebensschuld“ von Juden, die den Holocaust überlebt haben. Die war zuweilen derart quälend, dass sich Überlebende noch Jahrzehnte später umgebracht haben – als verdankten sie ihr Überleben einer untilgbaren Schuld.
Bei diesen Beispielen ist offensichtlich, dass die Schuldgefühle objektiv falsch sind – weshalb ich von einer Schuldenfalle spreche. Schuldgefühle verweisen nicht auf eine reale Schuld, sondern auf eine Situation, ein Unglück, einen Schicksalsschlag, der nicht zu ertragen ist. Schuldgefühle sind immer objektiv falsch. Wer sich tatsächlich schuldig gemacht hat, leidet meist nicht unter Schuldgefühlen, sondern hat Hunderte von Gründen, warum er dennoch unschuldig ist. Deshalb kann man behaupten, dass das Vorliegen von Schuldgefühlen grundsätzlich für die objektive Unschuld des von ihnen geplagten Menschen spricht!
Warum aber hat ein Mensch dann Schuldgefühle, warum quält er sich mit solchen? Bei Schuldgefühlen geht es primär nicht um Regelverstöße, die jemand begangen hat, sondern um das Leid der Mitmenschen, auch wenn man es selbst nicht verursacht hat. Schuldgefühle haben die wichtige soziale Funktion, anderen Menschen beizustehen und stellen ein Gegengewicht zum vom Existenzkampf aufgenötigten Egoismus dar. Und Schuldgefühle entstehen aus der Wahrnehmung der Differenz zwischen dem eigenen, besseren Zustand und der schlechteren Situation anderer Menschen. Derart löst das aus Empathie für das Leid anderer Menschen abgeleitete Schuldgefühl spontane Bereitschaft zur Hilfeleistung aus. Dieses Verhalten ist schon bei Kindern im Alter von 20 Monaten zu beobachten, die bei einem Spielgefährten, dem ein Missgeschick passiert, direkt alle Trost- und Hilfsmöglichkeiten ausschöpfen. Wenn aber keine substanzielle Hilfe möglich ist, bleibt der Hilfsbereitschaft nur mehr der Ausweg in die Schuldgefühle als eine Art von Phantomschmerz. Das Schuldgefühl schützt uns so vor einem anderen Gefühl, das noch schwerer zu ertragen wäre.
Darauf wird zurückzukommen sein, zunächst aber zu den Schuldgefühlen von Angehörigen, um die es hier vor allem geht. Obwohl Angehörige nicht selten am Rande der Selbstaufgabe stehen, um eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung ihres pflegebedürftigen Partners oder ihrer alten Eltern oder ihres kranken Kindes sicherzustellen, obwohl sie auf Urlaub verzichten, Hobbys und Freunde vernachlässigen, quält sie am Ende des Tages ein schlechtes Gewissen, ob sie genug getan haben. Solch quälende Schuldgefühle werden noch vergrößert durch das (ebenso objektiv unzutreffende) Gefühl, für die Behinderung, Erkrankung oder das krisenhafte Alter Mitverantwortung zu tragen. Wer sich länger mit Angehörigen unterhält, wird immer wieder darauf stoßen, dass sie sich am Schicksal ihrer Eltern, Kinder oder Ehepartner mitschuldig fühlen. Beziehungsweise sich schuldig fühlen, weil sie das Leid und Unglück nicht im Nachhinein mildern oder rückgängig machen können.
Gibt es aus dieser besonderen Art der ‚Schuldenfalle‘ keinen Ausweg? Bevor eine Art von Ausweg skizziert wird – erstaunlicherweise ist dieser Weg durch die Bewusstmachung, durch das Eingeständnis und die Anerkennung von Schuldgefühlen charakterisiert – sollen zwei verschiedene, gleichermaßen ungesunde Arten, mit Schuldgefühlen umzugehen, erläutert werden, die für die Betroffenen selbst und manchmal auch für deren Mitmenschen zu einem Problem werden können. Dabei lässt sich auch erklären, welchen funktionalen Sinn Schuldgefühle, wenn sie nicht auf reale Schuld verweisen, haben.
Der typische Weg, die eigenen Schuldgefühle zu bearbeiten, ist die Flucht in eine Überaktivität. Menschen, die unter einer Krankheit, einem Unglück oder einem krisenhaften Alter leiden, werden bei ihren Nächsten immer eine besondere Art des Mitgefühls auslösen. Hilf- und Heillosigkeit, insbesondere in extremen Ausprägungen, haben einen appellativen Charakter: Der damit konfrontierte, mitleidende Mensch wird sich in eine zum Teil blinde Aktion stürzen, wird mit allen Mitteln versuchen, das Leid zu beseitigen, zu mildern oder rückgängig zu machen. Wenn und wo das nicht gelingt, nagt der Skandal des Leids weiter an den helfenden Menschen und potenziert womöglich das Hilfsverhalten. Daraus wird nicht selten ein regelrechter Teufelskreis aus Schuldgefühlen und anhaltenden Versuchen zu helfen. Bei sogenannt professionellen Helfern, die ebenfalls betroffen sein können, spricht man in diesem Kontext vom Helfer- oder Burnout-Syndrom, bei Angehörigen von Alkoholabhängigen spricht man von Co-Abhängigkeit, was auch eine Form der falsch verstandenen, sich selbst schädigenden Hilfe meint.
Das Helfenwollen überspielt dabei die eigene Hilflosigkeit und die Einsicht, einem leidenden Mitmenschen nicht grundsätzlich helfen zu können. Aus diesem Teufelskreis entsteht leicht Überforderung, schließlich sogar Ausgebranntsein und Depression. Das Fatale daran ist, dass die anfängliche Hilfsbereitschaft, das hohe Engagement in Depression und manches Mal sogar in Aggression gegen die Hilfsbedürftigen umschlagen kann. Die Unzufriedenheit, die eigenen, (zu) hohen Ansprüche nicht erfüllt zu haben, wird in diesem Moment zu einer Gefahr für die hilfsbedürftigen Menschen. Der (überaus menschliche) Fehler liegt darin, dass der Betreuende das Leid nicht aushalten konnte, es wegmachen wollte, es per hilfloser und panischer Hilfe aus der Welt schaffen wollte. Erst wer schmerzhaft spürt, dass selbst eine Rundumbetreuung ein Leben nicht leidensfrei machen kann, weil Leid ein integraler Bestandteil menschlichen Lebens ist, kann die schwierige Balance zwischen tätiger Hilfe, Milderung von Leiden und Anerkennung von Unabänderlichem erlernen.
Im letzten Satz habe ich schon einen Weg weg von den quälenden Schuldgefühlen skizziert. Bevor ich eine einfache, aber nicht einfach zu praktizierende Lösung anbiete, noch ein Blick auf die zweite ungesunde Strategie, mit Schuldgefühlen umzugehen. Die erste bestand daran, sich in eine panische Überaktivität zu flüchten – was niemandem hilft und zudem die geschilderten Folgen eines Burnouts oder einer Depression haben kann. Die andere Strategie, Abstand von Schuldgefühlen zu nehmen, ist ein verbreitetes Gesellschaftsspiel: „Wer ist schuld?“ Dieses Spiel, bei dem alle versuchen, ihre Schuld zu verschieben, andere Schuldige ausfindig zu machen, Schuld zu teilen, ist auch deshalb so beliebt, weil unsere Zeit nicht nur an die Kausalität glaubt, sondern auch daran, dass alles machbar ist, dass der Mensch alles selbst in der Hand hat, also Schuld haben kann.
Menschen suchen überall nach einer Bedeutung, um Geschehenes zu erklären, zu verstehen und aushalten zu können. Je bedrängender etwas ist, umso schärfer stellt sich die Frage nach dem Grund, nach dem Sinn des Geschehenen. Die verbreitete Sinngebung von Ereignissen endet in Schuldzuschreibungen. Selbst wenn der Mensch schlechte Laune hat, tendiert er dazu, irgendwen für die eigene, schlechte Stimmung verantwortlich zu machen. Es ist noch gar nicht lange her, so wenigstens behaupten das Ethnologen, da hat man jeden Tod als Folge einer Fremdeinwirkung, als unnatürlich interpretiert. Noch weniger lange ist es her, da hat man Versündigung oder Unmoral für die Entstehung von Krankheiten verantwortlich gemacht. Der Mensch tendiert grundsätzlich dazu, sich persönlich gemeint zu fühlen, schon Kinder verarbeiten auf diese Weise Trennungen: Bei einer Scheidung der Eltern entwickeln fast alle Kinder Schuldgefühle, als hätten sie Verantwortung für das Scheitern der Ehe.
Diese Manie, überall nach Sinn und Bedeutung, sprich Schuld zu suchen, ist natürlich erst recht gegeben, wenn der Mensch einem Ereignis gegenübersteht, das er nicht handelnd ändern kann. Gerade Zwangslagen des Lebens wie Entsagung, Not und Unglück schreien nach Bedeutung. Als Zufall eines schweigsamen, dem Menschen gegenüber indifferentem Universum sind sie noch schwerer auszuhalten. Wenn man keinen ‚echten Sinn‘ mehr in einem Ereignis erkennen kann, dann kann man wenigstens fragen, wer hat das Unglück verursacht. Genau dieser Schuldfrage widmet sich die moderne Gesellschaft mit Besessenheit: Wenn irgendetwas Schreckliches passiert, dann ist, noch bevor man die Verunglückten betrauert, die erste Frage immer die nach dem Schuldigen. Mit den vom Unglück betroffenen Menschen hat das tragisch-alberne Gesellschaftsspiel nichts zu tun, sie werden dazu instrumentalisiert, dass „so etwas nie wieder passieren kann“ – was ihnen nicht hilft und das Geschehen auch nicht rückgängig macht. Das Gesellschaftsspiel hat genau den gleichen Grund wie die Schuldgefühle: Sie dienen der Abwehr von Ohnmachts- und Hilflosigkeitsgefühlen. Schuldgefühle entstehen aus dem Bedürfnis nach Erklärungen für überfordernde Situationen. Besser Schuld haben, als hilflos zu sein, besser verursachender Täter sein als bloßes Opfer.
Leid, Unsicherheit, Hilflosigkeit und die Abwesenheit von wirklichen Schuldigen werden selten konstruktiv bewältigt, sondern mit Schuld wird panisch und gleichermaßen erfolglos an der Verdrängung des Gefühls der Ohnmacht gearbeitet. Hilflosigkeit fördert Aggression und Wut sucht sich Schuldige. Früher und heute waren es vornehmlich die Juden, die als Sündenböcke herhalten mussten. Alle Verschwörungsfantasien erzählen die Mär einer jüdischen Weltverschwörung. Auch Frauen wurden zu Sündenböcken gemacht, als Hexen tituliert und verbrannt, weil die, die Leben gebären können, als naturnäher angesehen wurden und deshalb bei Seuchen und Katastrophen verantwortlich gemacht wurden. So kann das Schuldspiel das Zusammenleben vergiften, weil Menschen Zufälle, Tragödien und Ambivalenzen nicht aushalten können, weil es schwer ist, nicht zu wissen, wie es weitergeht und wie es ausgeht. Irgendjemand muss schuld sein, jede andere Erklärung als die Existenz von Schuldigen ist unerträglich. Alles scheint besser zu sein, als Ohnmacht im Angesicht einer Tragödie oder eines Schicksals.
Entsprechend begeistert wird das Schuldspiel am Leben erhalten. In Pflegeeinrichtungen kann man beobachten, wie die Beteiligten sich gegenseitig mit Schuldvorwürfen behelligen, wie sie Schuldgefühle wie scharfe Hunde aufeinanderhetzen. Als wären noch nicht genug Schuldgefühle versammelt, darf nicht vergessen werden, dass auch der Hilfsbedürftige selbst meistens unter solchen leidet. Schon deshalb, weil er sich als Ballastexistenz empfindet, weil er anderen Menschen Mühe macht. Außerdem tendieren Betroffene dazu, die Krankheit oder das krisenhafte Alter als persönlich verschuldete Niederlage zu interpretieren.
Schuld ist genau genommen gar keine Sinngebung, sondern nur ein Sinnersatzstoff, der schnell süchtig macht – aber nicht satt. Er verhindert Akzeptanz und perpetuiert eine komplizierte Trauer, die nicht enden will. Die entsteht z. B., wenn man sich die Schuld an der Selbsttötung eines Zugehörigen gibt oder auch, wenn man für den Tod eines Nächsten einen anderen Menschen oder menschliche Einwirkung insgesamt verantwortlich macht.
Alle Versuche, Schuld wegzudiskutieren, sie zu teilen sind, so war zu sehen, genauso zum Scheitern verurteilt wie handelnde Abarbeitung von Schuld. Weder sind Schuldgefühle Diskussionen gegenüber zugänglich, lassen sich nicht durch Realitätsprüfungen entkräften, noch hilft es, Gegenrechnungen aufzumachen und so Schuld zu verschieben. Ergo müssen Menschen, auch wenn sie objektiv unschuldig sind, mit Schuld und Schuldgefühlen leben! Dostojewski wollte das Prinzip der Schuld zur Grundlage aller menschlichen Beziehungen machen, Schuldgefühle sind derart Verpflichtungsgefühle gegenüber unseren Nächsten. Und sie haben etwas damit zu tun, dass Menschen in einer anhaltend gewalttätigen, ungerechten und grausamen Welt leben, wo es dem Einen bessergeht, weil er verschont bleibt von Katastrophen und Krankheiten, und dem Anderen schlechter. Wobei das Glück des Einen und das Unglück des Anderen eine Verbindung hat, womöglich eine kausale, sodass Glück und Unglück einander bedingen. Weil nur der Zufall über unseren jeweiligen Platz auf der Welt entschieden hat, gibt es eine Verpflichtung nicht nur für den Nächsten, sondern sogar für den Fernsten. Schuldigsein ist laut Dostojewski deshalb ein anderes Wort für Mitmenschsein!
Schuld als ein derart penetrantes Gefühl anzuerkennen, ist der erste Schritt zum Verständnis dieses Gefühlszustandes mit einer langen Geschichte. Einige Philosophen und Psychologen meinen gar, Schuldgefühle wären die erste Form der Verinnerlichung gewesen. Das ist zwar spekulativ, aber die Bedeutung von Schuld und Schuldgefühlen für den Menschen kann kaum überschätzt werden. Alle Religionen fußen auf massiven Schuldgefühlen: Gläubige stehen in der Schuld Gottes, werden schon mit einem Erbsünde-Paket geboren, das niemals abzuschütteln sein soll. Schuld bindet an Übersinnliches. Das erste Motiv für Schuld ist der brutale Naturschrecken, mit dem sich die „ersten“ Menschen herumschlagen mussten. Die Tragödie der Naturkatastrophen war unaushaltbar und wurde in Schuld übersetzt. So hat der Mensch die Tragik des Lebens in illusionäre Schuld verwandelt und tut das noch heute mit Vorliebe. Anders war die damalige Wirklichkeit (und noch heute manches Schicksal) nicht auszuhalten.
Wer diese Herkunft der Schuldgefühle kennt, wundert sich nicht mehr über die Löschungsresistenz dieser sehr alten, archaischen Gefühle. Auch der heutige Mensch gibt sich die Schuld an Ereignissen, denen gegenüber er hilflos war. Wenn man sich die Schuld an einem Ereignis gibt, das man weder hat herbeiführen noch vermeiden können, tut man so, als hätte man die Macht über das Ereignis in der Hand gehabt. Schuldgefühle sind (invertierte) Allmachtsfantasien, sind illusionäre Machtgefühle. Mitfühlender gesprochen: Statt sich eingestehen zu müssen, dass man nichts hat ausrichten können, dass man ohnmächtig war, statt die Übermacht der Realität zu akzeptieren, erhält man per Schuldgefühl die Illusion des Einflusses auf die Wirklichkeit aufrecht. Es gibt wenige Gefühle, die für den Menschen so unerträglich sind wie die des Ausgeliefertseins, der Hilflosigkeit und Ohnmacht, da sie dem Selbstbild des aktiven und aller Realität gewachsenen Menschen widersprechen. Da sind Schuldgefühle die vermeintlich bessere Alternative.
Doch auch Schuldgefühle können die von ihnen Betroffenen nur sehr kurzfristig vor der Wahrnehmung einer schonungslosen Realität schützen. Die Zuschreibung und Verschiebung von Schuld statt der Akzeptanz von Schwererträglichem ist ein Versuch, das Schicksal abzuwehren und nicht verarbeiten zu müssen. Das heißt, die Spirale aus Vorwürfen und Schuld lässt sich nur durchbrechen, wenn man lernt, dass es tatsächlich Dinge gibt, die auf unangenehme Art und Weise größer als die eigenen Wünsche sind. Der nächste Schritt ist die Anerkenntnis der menschlichen Insuffizienz im Anbetracht von schwerem Leid. Nur durch das schmerzhafte Eingeständnis der Ohnmacht, nur durch Kapitulation kann man Schuldgefühlen entkommen. Schmerzhaft heißt, gegen Schuldgefühle hilft, sich hinzusetzen und sich zu sagen: „Ja, demgegenüber, was mein Verwandter aushalten muss, bin ich genauso hilflos wie er.“ Wer darüber weinen kann (womöglich gemeinsam), hilft sich und vermeidet Schuldgefühle. Wenn nichts mehr geht, wenn der Mensch seine Unterlegenheit eingestehen muss, hilft immer noch, wenn auch nur ein bisschen, zu weinen, denn dort wird die Kapitulation, die ein passives Ertragen ist, zu einem ‚halbwegs aktiven‘ Tun. Und vor schwerer Krankheit, vor Sterben und dem Tod können wir alle nur kapitulieren.
Um eine andere Sicht auf Schuldgefühle zu bekommen, ist derart ein strenger Realismus hilfreich. Der Mensch ist nur selten der Mächtige, der Kontrolleur der Wirklichkeit, sondern überwiegend ohnmächtig. Übrigens: Die größte (und einzige) Hilfe, die der Mensch anbieten kann, ist, das Gegenüber nicht allein zu lassen, zusätzlich das Vertrauen darin, dass Menschen auch mit schwierigen Situationen umgehen können, dass sie ihr Leben, ihr Leid, ihr Schicksal aushalten können. Womit sich der Kreis schließt, denn wie ausgeführt sind Schuldgefühle Ausdruck meiner inneren Beziehung zu dem Menschen, mit dem ich mitfühle. Wer jetzt über die Kürze der Lösung verwundert ist, dem kann man nur erwidern, dass es tatsächlich so einfach ist, nur ist das Einfache, wie zu sehen war, oftmals viel schwieriger als sich auf diverse Kämpfe und Nebenkriegsschauplätze einzulassen. Um der eigenen Hilfe wieder mit Wertschätzung und Ermutigung begegnen zu können, sollte man Schuldgefühle gelassen akzeptieren.
Dr. Georg Salzberger
SpargelessenSpargelessen gehört für unsere Bewohnerinnen und Bewohner zum Frühling einfach dazu und wird in unseren Einrichtungen angeboten – hier in unseren Häusern Stephanus und Paulus.
Urban Sports-MitgliedschaftAlle Mitarbeitenden des Clarenbachwerks erhalten ab 1. Juni 2025 bei Urban Sports eine vergünstigte Mitgliedschaft – der Arbeitgeber bezahlt den Großteil des Monatsbeitrags: S-Tarif 0 € statt 33 €, M-Tarif 9,90 statt 69 €, L-Tarif 39,90 statt 109 €, XL-Tarif 89,90 statt 159 €.
Dabei können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deutschlandweit aus über 50 Sport-/Wellnessangeboten wählen, allein in Köln bei rund 950 Anbietern (bspw. Holmes Place, Yoga To The People, Neptun- bad) – vor Ort oder per Livestream. https://urbansportsclub.com/clarenbachwerk
Mehr Infos zum Angebot und der Nutzung erfahren Mitarbeitende bei einer Kick-off-Veranstaltung am 04.06., 13.30–14.30 Uhr: per Live-Übertragung im Heinrich Püschel Haus (EG) oder Zoom: Urban Sports-Experten beantworten dort alle Fragen.
Weiterbildung PflegedienstleitungHerzlichen Glückwunsch! Ihre Weiterbildung zur Pflegedienstleitung haben Frau Wedell und Frau Vural (Häuser Paulus/Stephanus) sowie Frau Özkurt (Anne Frank/Paul Schneider Haus) bestanden und wurden von ihren Einrichtungsleitungen zum Zertifikat beglückwünscht – auch wir gratulieren zu der tollen Leistung!

