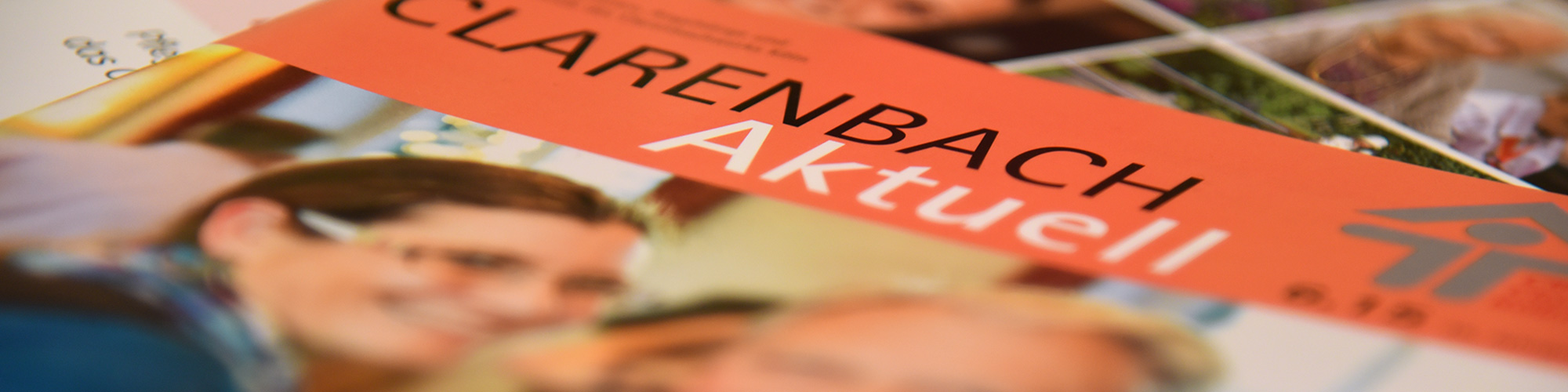Clarenbach Aktuell
Generationengerechtigkeit
29. April 2019
Wer schuldet wem was? Georg Salzberger beschäftigt sich aus Anlass eines neuen Buches über „filiale Schulden“, das sind Schulden der Kinder ihren Eltern gegenüber, mit Schuld und Schuldgefühlen in Familien.
Immer wieder wird über Generationengerechtigkeit diskutiert und gestritten, sowohl auf gesellschaftspolitischer Bühne als auch innerhalb der Familien selbst. In der Politik geschieht das sehr laut und es dreht sich um die Frage, wer sich bei unserem Rentensystem besser steht, die Alten oder die Jungen. Es geht um die unmoralische Frage nach dem Geld: wer schuldet wem was und wieviel?
Innerhalb der Familien wird diese Frage viel leiser diskutiert und es geht auch gar nicht primär um Geld, sondern um Moral – was die Sache keinesfalls einfacher macht. Wer schuldet wem was? Diese Frage beschäftigt vor allem die erwachsen gewordenen „Kinder“, die sich ihren alt und hilfsbedürftig gewordenen Eltern verpflichtet fühlen. Und die Frage ist Inhalt des gerade erschienenen Buchs von Barbara Bleisch, Warum wir unseren Eltern nichts schulden (Hanser Verlag). Die Autorin beantwortet diese Frage bereits im Buchtitel – und sicherlich richtig!
Ausgangspunkt der Überlegungen ist die Beobachtung, dass „Familie“ auch ein normatives Konstrukt ist. Aussprüche wie „Blut ist dicker als Wasser!“, Kinder werden „unter Schmerzen geboren“ zeigen, dass der Begriff der Familie hochheilig bzw. hoch ideologisch ist. Auch gibt es viele Beispiele, wo Eltern von ihren Kindern etwas verlangen und das offen oder versteckt mit ihrer „Vorleistung“ als Eltern rechtfertigen. Setzen Eltern nicht seit Jahrtausenden vor allem deshalb Kinder in die Welt, um als alte Menschen eine Daseinsvorsorge zu haben? Sind Kinder nicht die Rente der Eltern?
Was also schulden „Kinder“ ihren Eltern: an Besuchszeiten und an Betreuung. „Ist allein der Umstand, dass wir alle jemandes Kinder sind, auch ein Anlass für eine Verpflichtung diesen Menschen gegenüber?“, fragt Barbara Bleisch. Schon die Frage kann ungehörig sein, undankbar. Deshalb ist es gut, dass Bleisch die Frage nach der Schuld schon im Titel verneint. „Die Tiefenbohrung in diesem Buch gibt eine klare Antwort auf die Frage, was Kinder ihren Eltern schulden – nämlich nichts.“ Schon allein diese klare Absage an „filiale Pflichten“ ist mutig und macht die Lektüre lohnend! Gerade, wer sich fragt, inwieweit allein die Tatsache, von jemandem abzustammen, schon eine Verpflichtung miteinschließt, für den kann das Buch entlastend sein. Bleisch betont, dass es keine Pflichten über das hinaus gibt, was man allen Menschen schuldet. Es gibt keine filialen Pflichten.
Diese Absage an die Schulden der Kinder verdankt sich einer philosophischen Untersuchung. Abgeleitet wird die vermeintliche Schuld, so Bleisch, dabei aus den Mühen der Elternschaft. Kindererziehen ist zeitintensiv und anstrengend, außerdem noch teuer. Entsprechend wird die Sorge der Kinder für ihre alten Eltern schon in religiösen Schriften als Begleichung einer Schuld angesehen. Bleisch zeigt auf, dass die Beziehung zwischen Kindern und Eltern nicht die zwischen Gläubiger und Schuldner ist. Kurz gesagt: es gibt keinen Vertrag, den die Kinder unterschrieben hätten.
Sonst würden schon Neugeborene mit Schulden zu Welt kommen, was nicht weit von der Idee der Erbsünde entfernt wäre. Und wenn es doch eine Art von Verpflichtung gäbe, dann müsste natürlich auch gefragt werden, ob die Eltern ihren Verpflichtungen überhaupt nachgekommen sind. Wer als Kind vernachlässigend oder gar missbräuchlich behandelt wurde, hätte dann als Erwachsener keine Schulden, sondern in seiner Schuld stünden die Eltern. Schadensersatz statt Rückzahlung. Ein Geschenk, und sei es das des Lebens, begründet keinen Vertrag und schon gar keine Rückzahlung.
Wenn Elternschaft keine Altersvorsorge ist, weder finanziell noch emotional, wenn es also keine Schuld gibt, wie steht es dann um Dankbarkeit? Auch hier konstatiert die Autorin: Wofür sollten Kinder dankbar sein? Dass sie auf der Welt sind? Dass sie erzogen und geschlagen wurden, geliebt und vernachlässigt, gebildet und in Unkenntnis gehalten wurden? Ist das Leben überhaupt ein Geschenk? Kann man für etwas dankbar sein, dass man nicht ablehnen konnte?
Noch in einer Reihe von weiteren Kapiteln dekliniert die Autorin die Frage nach der Schuldigkeit durch. Und kommt immer wieder zu dem Ergebnis, dass der gesellschaftliche Generationenvertrag nicht heruntergebrochen werden kann auf die individuelle Beziehung zwischen den Kindern und Eltern einer Familie. Vielleicht, das Gefühl beschlich mich beim Lesen, ist die langwierige Diskussion, wo alle Argumente abgewägt werden, nicht nur ermüdend für den Leser, sondern auch Ausdruck von Schuldgefühlen, die per ausführlicher Diskussion gebannt werden sollen. Schuldgefühle sind aber Diskussionen gegenüber unzugänglich. Schuldgefühle kann man argumentierend nicht in den Griff kriegen bzw. in die Schranken weisen. Das Buch glänzt mit seinem Titel, dann aber verheddert es sich bei einer möglichst wasserdichten Argumentation, die schlussendlich, so mein Eindruck, die Schuldgefühle nicht zum Schweigen bringen können.
Das letzte Kapitel nimmt – dazu passend – einiges von der vorherigen Entschuldung wieder zurück: „Ich meine also, dass Kinder ihren Eltern nichts schulden, dass sie sich aber bemühen sollen, gute Kinder zu sein.“ Dann kriegt das Gegenüber, was es nicht einfordern „sollte, aber vielleicht doch verdient hat“. Da sind sie wieder, Schuld und Schuldgefühl. Und die ganze Diskussion hat daran nichts geändert. Wie gesagt, es ist ein Unterschied, ob man über Schuld im Vertragssinn spricht oder über Schuldgefühle, die damit nicht unbedingt etwas zu tun haben. Wer Schulden hat, hat längst noch keine Schuldgefühle, wer Schuldgefühle hat, hat deshalb nicht zwingend Schulden.
Das heißt, dass die Argumentation von Barbara Bleisch selbstverständlich richtig ist und dass Kinder ihren Eltern nichts schulden, aber die Argumentation kann die Schuldgefühle deshalb noch längst nicht zum Schweigen bringen. An einem Beispiel: Neulich demonstrierten in Berlin Eltern für genügend Kita-Plätze. Dabei statteten sie ihre Kleinkinder im Kinderwagen mit Schildern aus: „Ich will in die Kita!“ Man kann sich denken, dass diese Forderung auf allgemeine Zustimmung stieß. Umgekehrt wäre es keineswegs schicklich, dass erwachsene Kinder ihre dement gewordenen Eltern auf eine Demo begleiten und sie mit Schildern wie „Ich will ins Altenheim“ ausstatten würden. Das eine ist nicht unmoralischer als das andere (welches Kind will, noch bevor es sprechen kann, weg von Zuhause, welcher alte Mensch will in ein Heim?), dennoch erscheint die zweite Forderung unschicklicher.
Das Beispiel zeigt, wie leicht sich Schuldgefühle aktivieren lassen und wie wenig argumentativ gegen sie auszurichten ist. Bevor ich eine etwas andere Strategie zum Umgang mit ihnen vorschlage, soll vorher noch die Gegenfrage erlaubt sein. Gerade als Psychologe weiß man, dass für Kinder ihre Herkunftfamilie auch ein Verhängniszusammenhang sein kann. Jedenfalls behaupten Psychologen schon lange, dass niemand seinen Eltern irgendetwas schuldig ist. Im Gegenteil, Eltern machen sich ihrem Kind gegenüber schuldig, indem sie es ungefragt ins Leben katapultieren. Der Psychoanalytiker Sandor Ferenczi bemerkte, die Ungerechtfertigkeit der Existenz eines Einzelwesens – womöglich die Hauptfrage der Philosophie – sei nur aushaltbar, wenn Kinder „durch ungeheuren Aufwand an Liebe, Zärtlichkeit und Fürsorge dazu gebracht werden, es den Eltern zu verzeihen, dass sie es ohne seine Absicht zur Welt brachten“.
Allerdings ist auch diese Schuldzuschreibung wackelig: Der Mensch ist per se ein nicht zustimmungsgeklärtes Wesen. Die Frage, warum es überhaupt ein bestimmtes Individuum auf die Welt geschafft hat, ist keine psychologische Frage, sondern eine der vielen unbeantwortbaren philosophischen Fragen. Deshalb kann die ganze Nichtrechtfertigung des Lebens als solche niemandem zugerechnet werden. Natürlich trägt eine liebevolle Erziehung, die Art des Willkommens wesentlich zu einem zufriedenen Lebensgefühl der Kinder bei, lässt sozusagen die philosophische Frage leiser werden. Aber eine Schuld der Eltern lässt sich so nicht konstruieren, ist genauso wenig haltbar.
Wie zu sehen war, sind Schuldgefühle weder wegzudiskutieren noch hilft es, wie gerade versucht, eine Gegenrechnung aufzumachen und so Schuld zu verschieben. Beides sind gleichermaßen beliebte wie untaugliche Mittel im Umgang mit Schuld. Nicht einmal das Abtragen der Schuld durch Handeln lässt Schuldgefühle verstummen. Schuld ist derart ein sehr penetrantes Gefühl. Und es ist ein Gefühlszustand mit einer sehr langen Geschichte, ein fast schon archaisches Gefühl, welches weit an den Anfang der Menschheitsgeschichte zurückweist. Einige Philosophen und Psychologen meinen gar, Schuldgefühle wären die erste Form der Verinnerlichung gewesen. Dass ist zwar spekulativ, aber die Bedeutung von Schuld und Schuldgefühlen für den Menschen ist immens.
Alle Religionen ohne Ausnahme fußen auf massiven Schuldgefühlen: Gläubige stehen in der Schuld Gottes, christliche Gläubige werden schon mit einer Erbsünde geboren, die niemals abzuschütteln ist. Das gesamte Werk des russischen Schriftstellers Dostojewski ist durchzogen von der Suche nach einer Antwort auf die Frage der Schuld: Woher kommt sie? Und vor allem: Wie damit umgehen? In Schuld und Sühne stellt Dostojewski die (vergeblichen) Versuche dar, sich ihrer zu entledigen: „Jeder von uns ist vor allen anderen schuldig, und ich am allermeisten.“ Dostojewski zufolge sind alle Menschen schuldig, das Gefühl der Schuld ist nichts Zufälliges, sondern die Grundlage der Existenz.
Nach Sigmund Freud ist der Vatermord das Haupt- und Urverbrechen der Menschheit wie des Einzelnen, es ist jedenfalls die Hauptquelle des Schuldgefühls. Dabei muss das Verbrechen gar nicht real vollzogen werden, der Wunsch nach Überwindung des Vaters reicht schon, wie Freud anhand von Dostojewskis Lebensgeschichte erläutert hat: Der hatte kurz bevor sein Vater umkam, vom Tod des Vaters geträumt und sich deshalb eine Mitschuld am Tod des Vaters gegeben. Für Friedrich Nietzsche waren die vielen, vor allem religiös motivierten Schuldgefühle der Beginn des Leidens des Menschen an sich selbst, weil Schuldgefühle ein Angriff auf die vitalen Instinkte des Menschen seien. Nietzsche hat, auch weil ihn sein Leben lang ein ähnliches Schuldgefühl wie Dostojewski geplagt hat, in Schuld ausschließlich eine Kriegserklärung gegen die Instinkte der Kraft und Lust.
Allerdings hat Nietzsche das Motiv für dieses das Vitale schädigende schlechte Gewissen nicht sehen können. Es muss einen äußeren, sehr brutalen Naturschrecken gegeben haben, vor dem in die Innerlichkeit der Schuld geflohen wurde. Jetzt wird es gleichermaßen spannend wie spekulativ: Offenbar hat der „Urmensch“ gegen die viele Grausamkeit, der er in seiner Frühzeit ausgesetzt war, keine andere Gegenwehr gehabt, als dem Unglück, der Grausamkeit und dem Schrecken einen Sinn zu geben. Eine Qual, die zu nichts gut ist, die sinnlos ist – die hielt (und hält) der Mensch nicht aus. Deshalb hat sich der „Urmensch“ die Schuld am Schrecken gegeben, hat gemutmaßt, dass da, wo jemand ein Unglück aushalten muss, jemand von höheren Mächten bestraft wird, weil er sich etwas zuschulden hat kommen lassen.
So hat der Mensch aus dem Schrecken eine Schuld gemacht, hat die Tragik des Lebens in Schuld verwandelt – anders war die Grausamkeit der Welt (und noch heute manches Schicksal) nicht auszuhalten. Diese Sinngebung der Ungerechtigkeit und Grausamkeit der Welt geht zwar auf eigene Kosten (eben Schuldgefühle), aber immerhin sind die besser als ein sinnloses Leiden und eine gottlose Welt. An der Schuld ist etwas, was gegen den Schrecken schützt, der Schrecken bekommt eine Bedeutung und einen Sinn.
Wer diese Herkunft der Schuldgefühle in der Menschheitsentwicklung kennt, wundert sich nicht mehr über die „Löschungsresistenz“ von Schuldgefühlen. Auch heute melden sich Schuldgefühle besonders dann, wenn es um Notlagen geht. Auch der heutige Mensch gibt sich die Schuld an Ereignissen, denen gegenüber er hilflos, gar ohnmächtig war. Gibt man sich die Schuld, dann tut man so, als hätte man die Macht über das Ereignis in der Hand gehabt. Schuld ist insofern ein anderes Wort für (illusionäre) Macht. Mitfühlender gesprochen: Statt die Übermacht der Realität zu akzeptieren, erhält man per Schuldgefühl die Illusion des eigenen Einflusses auf die Wirklichkeit aufrecht: besser schuldig als ohnmächtig.
Deshalb müssen Menschen, auch wenn sie objektiv unschuldig sind, mit Schuld und Schuldgefühlen leben. Dostojewski schlägt vor, das Prinzip der Schuld zur Grundlage der intersubjektiven Beziehungen zu machen. Schuldgefühle sind derart Verpflichtungsgefühlegegenüber unseren Nächsten. Und sie haben etwas damit zu tun, dass Menschen in einer anhaltend gewalttätigen, ungerechten und grausamen Welt leben, wo es dem Einen besser geht, weil er verschont bleibt von Katastrophen und Krankheiten, und dem Anderen schlechter. Und wir ahnen, dass das Glück des Einen und das Unglück des Anderen eine Verbindung haben, womöglich eine kausale, sodass Unglück und Glück einander bedingen. Weshalb wir uns mitschuldig am Unglück aller Mitmenschen fühlen – anders wäre es noch schwerer auszuhalten. Weil nur der Zufall über unseren jeweiligen Platz auf der Welt entschieden hat, gibt es eine Verpflichtung nicht nur für den Nächsten, sondern sogar für den Fernsten. Schuldig sein heißt, sich nicht aus dem Staub machen können, die Verbindung nicht lösen zu können, heißt Mitmensch sein.